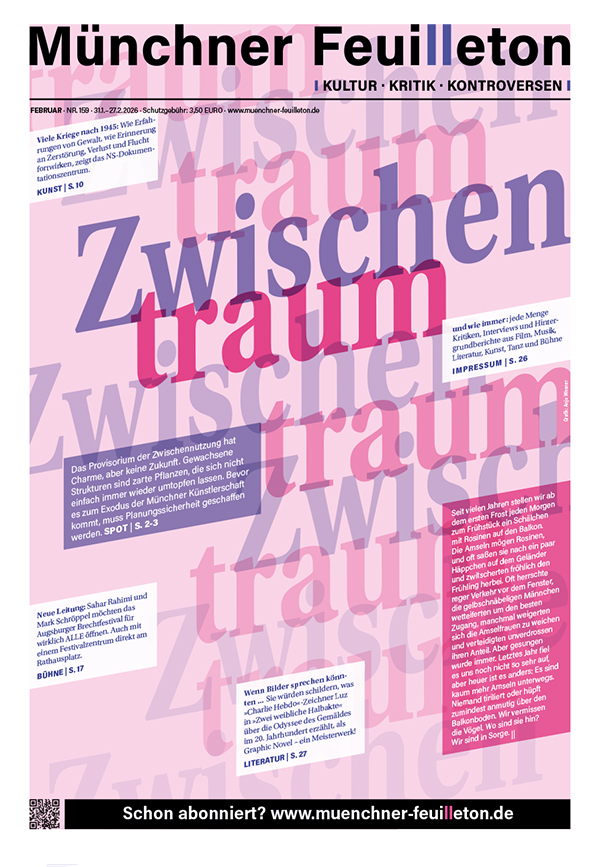Das Architekturmuseum widmet geheimnisvoll undurchschaubaren Rechenzentren, künstlichen Seen, Landschaften aus Kabeln und Satelliten eine Ausstellung über die Wolken, in denen mittlerweile nahezu jeder sein Leben hortet.
Wie praktisch: Wir alle speichern unsere Daten gedankenlos in der Cloud. Wissen ersetzen wir durch KI. Fotos und Filmchen laufen über die Social-Media- Kanäle in nicht mehr fassbaren Mengen. Tatsächlich liegen unsere Daten aber nicht in der Wolke, sondern in weltweit 10.000 Rechenzentren, irgendwo auf oder unter der Erde. Welche tiefgreifenden Konsequenzen dies für die Natur, unsere Städte und für unsere Demokratien hat, versucht das Architekturmuseum der TU München anschaulich zu machen. Erst seit ein paar Jahren setzt sich die Erkenntnis durch, dass wir im Bauwesen nachhaltiger und energiesparender handeln müssen. Gleichzeitig ist uns aber der Energiebedarf, der für eine flächendeckende, alle Lebensbereiche durchdringende Digitalisierung nötig ist, bisher gänzlich egal. Dies ist vielleicht weniger dem Desinteresse als dem mangelnden Bewusstsein geschuldet. Deshalb ist diese Ausstellung so grundsätzlich notwendig. Sie geht weit über architektonische Themen hinaus und trifft ins Mark der globalen Prozesse, die momentan unsere Gesellschaften gravierend verändern. Eine von vielen Fragen, die Kurator Damjan Kokalevski stellt, betrifft jeden von uns: Was wollen wir noch alles opfern für unsere digitale Bequemlichkeit?
Der Betrieb von Rechenzentren verschlingt Unmengen von Energie. »Die einzige Quelle, die uns Verbrauchsdaten zu Rechenzentren liefern kann, sind die Betreiber selbst. Unabhängige Quellen gibt es nicht«, gibt Marina Otero Verzier zu Bedenken, die als Forscherin an der Ausstellung und am Katalog maßgeblich beteiligt war. »Das größte Rechenzentrum verbraucht ungefähr so viel Energie wie 3 Millionen Haushalte.« Beim Energiebedarf für eine einzige ChatGPT- Anfrage schwanken die Angaben zwischen 0,3 Wh und 2,9 Wh. Sam Altman, Chef von Open AI, nennt einen Verbrauch von 0,34 Wh.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß
»Im Zeitalter der industriellen Revolution haben Bahnhöfe unsere Städte sichtbar und prägend verändert. Die Infrastruktur der momentanen digitalen Revolution ist unsichtbar. Deshalb wollen wir den Bautyp des Rechenzentrums in den Mittelpunkt unserer Ausstellung stellen«, erklärt Andres Lepik, Direktor des Architekturmuseums. »Rechenzentren sind die größten und teuersten Bauten der Gegenwart.« Der Rundgang, der eigentlich keiner ist, sondern wie meist im Architekturmuseum im dritten Raum in eine Sackgasse führt, beginnt mit einer Infrastruktur, die bei ihrer Einweihung 1866 als achtes Weltwunder gefeiert wurde: das Transatlantikkabel. Damals für Telegrafie ausgelegt, sind auch seine Nachfolger für Telefon- und Internetleitungen bis heute unsichtbar – tausende Meter tief auf dem Meeresboden versunken. Im Vergleich zu den historischen Weltkarten mit den wenigen Unterseekabeln wirkt die heutige Weltkarte mit Datenleitungen wie die Flugrouten sämtlicher Airlines. Jede ist mit allem verbunden. So zeigt bereits der erste Raum den Anspruch der Kuratoren: sichtbar machen, was unsichtbar ist.
Das historische Ölgemälde des ersten Kabelleger-Dampfschiffes »Faraday« der Firma Siemens Brothers & Co aus dem Jahr 1874 bildet den analogen Auftakt der Ausstellung. In den folgenden drei Räumen versucht das Kuratorenteam um Damjan Kokalevski die wesentlichen Auswirkungen der neuen Datenflut anschaulich zu machen. Bewusst spröde, ja fast aseptisch technisch wie in einem Reinraumlabor für Computerchips haben die Gestalter von CPWH aus München die Stellwände, Projektionsflächen, Tische, Vitrinen und Sitzbänke gestaltet: Weiße kunststoffbeschichtete Platten sind auf gelochten Aluminiumprofilen eines Messebausystems befestigt, die nach der Ausstellung anderweitig wiederverwendet werden können.
Toxische Mikrochips
Im ersten Raum wird die elementare Dimension beleuchtet, also die chemischen Elemente, Rohstoffe und Halbzeuge, die unabdingbar zur Produktion von Mikrochips und Datenleitungen erforderlich sind. Gezeigt werden Fotos von dramatischen Eingriffen in die Natur, für den Lithiumabbau in Portugal und Zinnminen in Indonesien, ihre vergiftenden Auswirkungen auf Luft und Böden, Flächenfraß und einen ununterbrochenen Strom an monströsen Caterpillar-Schwerlastkraftwagen: ein immenser Verbrauch auch an Wasser und Energie. Über den edel funkelnden Gesteinsproben von Kupfer, Kobalt, Zinn und Gold pulsiert der aktuelle Aktienkurs für diese Rohstoffe als digitaler Echtzeitchart auf einem kleinen Bildschirm. Und wie sieht eigentlich Lithium aus? Das gelbe Pulver steht in einem kleinen Zylinder in der Glasvitrine.
Den ganzen Artikel gibt es hier im Kiosk.
Das könnte Sie auch interessieren:
»Freiheit ist das Beste von allem«: Ausstellung über Tove Jansson im Literaturhaus
Der digitale Impressionist: Immersive Ausstellung von Miguel Chevalier in der Kunsthalle München
Ausstellung "What the City" im alten Zeughaus: Blick zurück in die Zukunft
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!
Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.
Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.
JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton