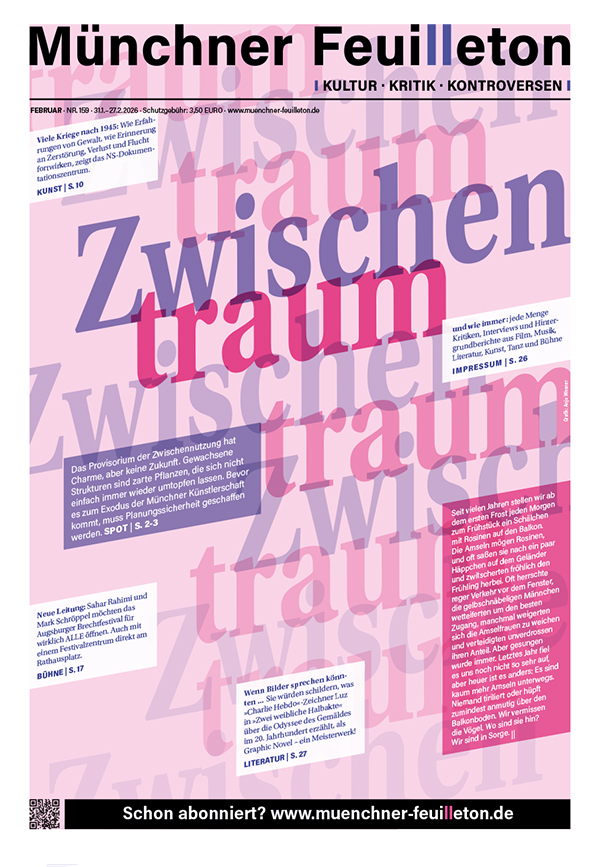Die Kunsthalle München feiert Miguel Chevalier und seine computergenerierte Kunst. Die interaktive Retrospektive »Digital by Nature« ist das Beste an programmierten, immersiven Artshows, was man seit langem gesehen hat.
Pixel statt Pinsel, animierte Bilder und ein 360-Grad-Erlebnis, das alle Sinne betört: Immersive Kunst liegt schon länger im Trend. Doch selten überzeugen die Lightshows im Museum. Das ist bei Miguel Chevalier anders. Der in Mexiko aufgewachsene Franzose nutzt den Computer bereits seit den 1980er Jahren als
kreatives Ausdrucksmittel. Er gilt als Pionier der digitalen Kunst, bezieht sich auf kunsthistorische Vorbilder und setzt für seine interaktiven raumfüllenden Kunstwerke auch auf Künstliche Intelligenz (KI).
Dass die Kunsthalle München den Pionier der digitalen Kunst nun erstmals in Deutschland in der bisher größten Einzelausstellung Europas präsentiert, füllt die Lücke der Museen. Vor allem aber ist die Schau »Digital by Nature« mit mehr als 120 Werken aus 40 Jahren ein sinnlicher Trip durch die Medienkunst des Franzosen, begleitet von den Kompositionen des Italieners Jacopo Baboni Schilingi.

Digital by Nature. Die Kunst von Miguel Chevalier, 12.9.2025 – 1.3.2026, Kunsthalle München © Miguel Chevalier, VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Foto: Thomas Granovsky
»Ich bin ein digitaler Impressionist«, sagte Miguel Chevalier bei der Eröffnung seiner Ausstellung. Und tatsächlich kommen einem Monets Seerosen in Erinnerung, steht man in dem virtuellen Meer aus Blüten und Blättern seiner aktuellen Installation »Meta-Nature AI«. Seitdem der 66-Jährige das Raumkunstwerk 2023 programmiert und erstmals ausgestellt hat, verändert es sich immer wieder. Betritt man den Raum und bewegt sich, kommen auch die Bilder in Bewegung. Mit jedem Schritt verändert sich die Kunst. Man hört elektronisches Klirren. Riesige Blätter der trendigen Monstera-Zimmerpflanze schwirren über die Wand, Farbnebel und zellenartige Waben wie unter dem Mikroskop tauchen auf und verschwinden wieder.
Miguel Chevalier sagt, dass er in Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz Datenbanken voller Bilder schafft. Er steuert das Ganze mit genauen Prompts, also Anfragen an die KI. So entstehen Strukturen von Bäumen, Blumen oder Blättern. Der Computer mixt und variiert sie bis zur Unendlichkeit. Alles scheint sich aufzulösen und neu zu entstehen, man sieht tatsächlich eine Art digitalen Impressionismus.
Natürlich hat den Künstler auch der berühmte Maler Claude Monet inspiriert. Er nennt aber auch Diego Rivera, Lucio Fontana,Yves Klein und Nam June Paik als künstlerische Vorbilder. Die ausladenden Wandmalereien des Mexikaners Rivera haben ihn schon als Kind fasziniert. Sein Vater, in den 1960ern Direktor der französischen Kulturinstitute Lateinamerikas, nimmt den Sohn oft in Museen und Paläste mit. Mit 19 Jahren geht der junge Chevalier nach Paris zum Studium. Eingeschrieben ist er für Kunst und Archäologie, aber der Computer, der in den 1980er Jahren aufkommt, zieht ihn ebenso in Bann. Über Beziehungen gelingt es ihm, im nationalen Rechenzentrum nachts erste Codes zur Bildbearbeitung auszuprobieren. Nach Mitternacht darf er an den Rechner. Ein Stipendium bringt ihn nach New York, wo er am Pratt Institute und der School of Visual Arts an ersten Grafikkarten tüftelt und eine einfache Zeichensoftware entwickelt. Als nostalgische Erinnerung an seine Anfänge ist in der Ausstellung Chevaliers erster Commodore Amiga 1000 aus dem Jahr 1985 zu sehen, ein sperriger grauer Kasten, der heute wie ein Fossil aus alten Zeiten wirkt.
Spielerisch setzt der Künstler heute die Technik ein – und bindet dabei die Betrachter mit ein. Nicht nur Kinder lieben es, in der Ausstellung am Computer eigene Pflanzen zu kreieren, die »Pixel Flowers« finden sich nebenan in einem Gewächshaus wieder. Chevaliers bisher größter virtueller Garten ist ein kreativer Spielplatz für Jung und Alt.
Aber auch Kunst aus dem 3-D-Drucker fabriziert der Künstler am laufenden Band. Man sieht Kunstharz-Blumen, gefaltete Skulpturen und den Kopf des römischen Gottes Janus. Knallrot leuchtet er in einem Raum, als ob er aus tausenden von Legosteinen geformt wäre, und blickt mit seinen zwei Gesichtern sowohl in die Zukunft wie in die Vergangenheit. Der Künstler denkt gern dreidimensional. In einem frühen Werk setzt er dafür noch Spiegel ein. In der Metallbox »Infinite Hexadecimal Memory Window« aus dem Jahr 1992 verflüchtigen sich Reihen von Computerzahlencodes in die Unendlichkeit.
Anderenorts lässt er überdimensionale Gitter-Sphären entstehen, die von der Decke hängen. Oder wie fluoreszierende Bienenwaben den Besucher in ihrem Geflecht einzufangen scheinen. Vieles erinnert an Wurzelvernetzungen wie in der Natur. Folglich heißt die Arbeit auch »Rhizomatic«, was sich sowohl auf das Pflanzenwurzelwerk »Rhizom« bezieht wie auf das postmoderne Wissensmodell der Kunstphilosophen Deleuze und Guattari.
Überhaupt ist es eine wahre Freude, wie sehr sich Chevalier auf die Kunstgeschichte bezieht: Man denkt an die Bilder der Naturforscherin Maria Sibylla Merian aus dem 17. Jahrhundert oder die »Kunstformen der Natur«, Zeichnungen von Meerestieren oder Einzellern, mit denen der deutsche Zoologe Ernst Haeckel Ende des 19. Jahrhunderts Furore machte. Aber auch an barocke Ornamentik und islamische Muster. »KI ist eine Erweiterung meiner Kreativität «, sagt Miguel Chevalier. Er weiß aber auch: »Ohne die Vorstellungskraft des Künstlers ist die KI nichts.« ||
DIGITAL BY NATURE.
DIE KUNST VON MIGUEL CHEVALIER
Kunsthalle | Theatinerstr. 8 | bis 1. März 2026
tägl. 10–20 Uhr | Der Katalog (126 S., Hirmer
Verlag) kostet in der Ausstellung 25, im Buchhandel
39,90 Euro | www.Kunsthalle-muc.de
Das könnte Sie auch interessieren:
»Freiheit ist das Beste von allem«: Ausstellung über Tove Jansson im Literaturhaus
Wollen wir ein wenig miteinander denken? - Filmkritik zu "Leibniz - Chronik eines verschollenen Bil...
Mehr als ein Spielplatz: Ausstellung im Haus der Kunst
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!
Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.
Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.
JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton