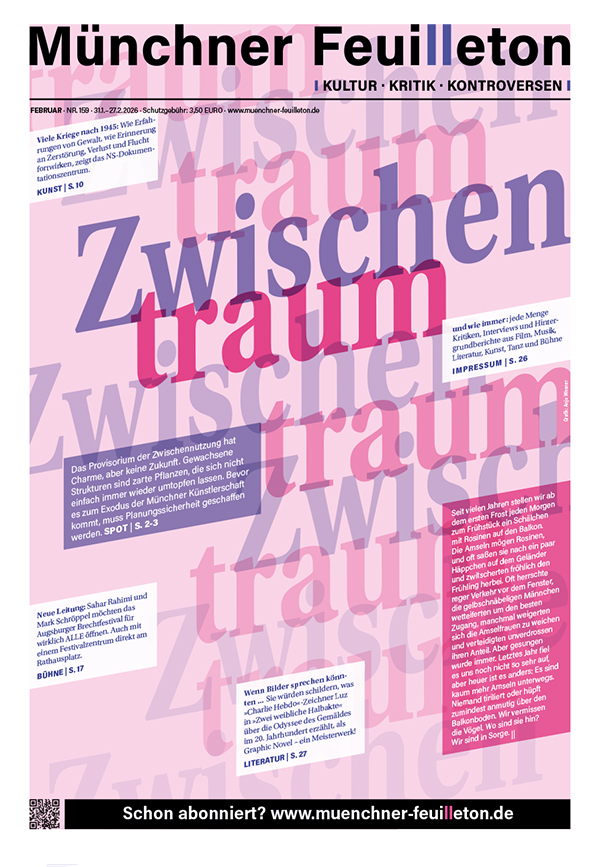Der mittlerweile 93 Jahre alte Edgar Reitz setzt dem großen Erfinder und Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz ein filmisches Denkmal. Ein Gespräch mit dem Regisseur über seinen neuen Kinofilm „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“.
MF: Ihr neuer Film über den Philosophen Leibniz ist ein intimer, bildungsreicher Film – getragen von Sprache, präzisem Denken und einem genauen Blick. Was war Ihre zentrale inszenatorische Idee beim Zugang zur Figur?
Edgar Reitz: Da gab es mehrere Ebenen. In all meinen bisherigen Filmen hatte ich es mit Lebensräumen zu tun, die ich kannte, Milieus, in denen ich gelebt habe, mit unmittelbarer Anschauung. Bei einer Figur aus der Barockzeit wie Leibniz ist das völlig anders. Niemand auf dieser Welt war je wirklich da, wo Leibniz gelebt hat. Natürlich gilt das für jeden historischen Stoff, aber ich habe das zum ersten Mal so hautnah erlebt.
Etwa im Vergleich zur Anderen Heimat …
Die spielt im 19. Jahrhundert, aber in einer Gegend und in einem Milieu, das ich kenne. Ich wusste, welche Werkzeuge die Menschen damals hatten, welches Wissen, wie sie lebten, was sie aßen. Bei der Anderen Heimat haben wir das sogar in der Herstellung der Schauplätze angewendet, also beim Bau der Häuser, bei der Ausstattung. Jetzt war das nicht mehr möglich.
Wie haben Sie auf diese Anforderung reagiert?
Ich bin auf eine große Motivsuche gegangen, auf der Suche nach einem Barockschloss, das sich für den Dreh eignet. Aber ich habe schnell gemerkt: Die Orte sind heute nicht mehr authentisch. Alles ist touristisch überformt, künstlich. Es stellt sich ein Gefühl von Unwirklichkeit ein. Wir haben schließlich beschlossen, die Räume im Studio zu bauen. Aber das heißt auch: Alles, was ich dort sehe, kommt ausschließlich von mir. Ich stehe einer Welt gegenüber, die es nur gibt, weil ich sie gewollt habe. Und da spürt man schnell: So geht das nicht. Ich brauche ein Gegenüber, etwas, das nicht von mir kommt.
Wir haben begonnen, Requisiten und Raumelemente zusammenzutragen, die mit unserem Film eigentlich nichts zu tun hatten. Wir haben uns gesagt: Das ist ein Raum, in dem Leibniz mal gearbeitet hat, aber jetzt steht er seit 20 Jahren leer. Zwischenzeitlich war er Lager für Gartenfeste oder für die Werkzeuge der Gärtner. So entstand ein Raum mit Geschichte.
Also nicht historische Genauigkeit im engeren Sinn – sondern atmosphärische Glaubwürdigkeit?
Krasse historische Verstöße haben wir natürlich vermieden. Das würde den Zuschauer rauswerfen. Aber es gab Grenzfälle, bei denen wir gesagt haben: Das ist denkbar, also geht es.
Sie beschreiben das Studio fast wie einen lebendigen Organismus.
Die ganze Dreharbeit über wurden neue Dinge in den Raum eingebracht, oft ohne Absprache. Ich kam morgens ans Set, da stand wieder irgendetwas Neues da. Der Raum bekam ein Eigenleben. Und sich mit diesen Zufällen auseinanderzusetzen, das war für mich die zweite Inspirationsquelle.
Sie haben einmal gesagt, für Sie sei bei der Inszenierung das Körpergefühl im Raum zentral. Können Sie das etwas näher erläutern?
Die Schauspieler bewegen sich in einem gedachten Raum. Wie fühlt man sich körperlich in einem erzählten Raum? Das Körpergefühl war der Ausgangspunkt der Inszenierung. Welche Wege geht man? Wo setzt man sich hin – oder eben nicht, weil es keinen Stuhl gibt? Diese Entscheidungen sind wesentlich. Ich glaube, das hat der Arbeit mit den Schauspielern ein Element von Abenteuer verliehen.
Es gibt Regisseure, die sind Ego-Shooter, sehr effektiv. Aber ich zähle mich eher zu den Gärtnern. Ich pflanze etwas und dann schaue ich, was wächst. Ich habe den Anspruch, dass sich im Spiel etwas ereignet, das ich nicht planen kann, etwas, das entsteht.
Der Film hat eine längere Entstehungsgeschichte hinter sich. Der Stoff hat eine Weile gebraucht, bis er seine finale Form gefunden hat, richtig? Gab es Hürden bei der Finanzierung?
Ich habe über zehn Jahre an dem Thema gearbeitet. Die ersten Entwürfe entstanden noch vor Die andere Heimat. Mein ursprünglicher Ansatz war, ein großes Biopic zu machen. Das hätte ein weites Zeitbild erfordert. Schließlich wurde Leibniz in den letzten Jahren des Dreißigjährigen Kriegs geboren, in einer Welt, die wie eine Nachkriegslandschaft aussah. Zerstörte Städte, verbrannte Landstriche. Das hat mich sehr an die Nachkriegszeit nach 1945 erinnert. In dieser Welt ist ein Geist wie Leibniz herangewachsen.
Doch je weiter ich kam, desto mehr merkte ich, dass ich mit diesem Ansatz in Dimensionen gerate, die für eine deutsche Produktion nicht zu bewältigen sind. In einer Version hätten wir 150 Statisten gebraucht, eine kleine Armee, Pferde, Städte.
Die entscheidende Wendung kam hier an diesem Tisch, mit meinem Co-Autor Gert Heidenreich und dem Produzenten Ingo Fliess. Wir hatten uns gerade schweren Herzens entschlossen, das Projekt fallen zu lassen, da sagte Ingo beim Hinausgehen: „Was mir am meisten leidtut, ist die Anfangsszene, in der das Porträt von Leibniz gemalt werden soll.“ Also gingen wir zurück an den Tisch und haben überlegt, ob das nicht der Weg ist. Von da an ging es ganz schnell: In drei Monaten hatte Gert Heidenreich das neue Drehbuch fertig, drei weitere Monate später hatten wir die Finanzierung, bis auf einen kleinen Einspruch der Filmförderung, der dann aber ebenfalls positiv beschieden wurde. Gedreht haben wir dann ab September, in 30 Tagen.
Welches Budget stand Ihnen zur Verfügung?
Wir hatten ein vergleichsweise kleines Budget: knapp 3 Millionen Euro.

Leibniz (Edgar Selge) und seine Malerin Aaltje van de Meer (Aenne Schwarz) | © Ella Knorz
Mit Leibniz haben Sie einen Film geschaffen, der zentral von der Malerei handelt. Vom Philosophen Leibniz soll im höfischen Auftrag ein Porträt entstehen. Dabei geht es auch um das „Malen mit Licht“, wie es die Figur der Malerin Aaltje Van De Meer, gespielt von Aenne Schwarz, beschreibt. Das ist ja fast eine Metapher für das Kino selbst.
Ja, das Licht ist für mich ein zentrales Element. Die alten Kinos hießen ja nicht umsonst „Lichtspielhäuser“. Das Licht auf der Leinwand, das ist der eigentliche Träger des Bildes. Es ist eine mysteriöse Kraft, ein Urelement. In der Genesis heißt es: Im Anfang war das Licht. Gott schuf die Welt durch das Licht. Es ist für mich ein schöner Gedanke, dass ich als Filmemacher sozusagen mit Licht erzähle, dass ich mit Licht Räume erschaffe, die Bilder.
Konkret wird das ja in der Projektion: Eine Lampe wirft das Bild – das rein immaterielle Lichtbild – auf die Leinwand. Das ist Magie. In der Malerei hat Caravaggio das Licht wie kaum ein anderer entdeckt. Er war ein wenig älter als Leibniz, aber seine Chiaroscuro-Technik war für uns eine Referenz.
Eine Technik, die von der schwarzen Leinwand ausgeht, auf der Pinselstrich für Pinselstrich das Licht Einzug hält, was für eine faszinierende Stimmung sorgt.
Ich habe gesagt: Wir haben zwei Wurzeln für unsere Bildgestaltung. Einerseits diese uralte Vorstellung: Die Welt entsteht aus Licht. Und andererseits: Die Malerei hat schon damals das filmische Licht entdeckt. Caravaggio war in gewisser Weise ein Vorläufer des Kinos.
Das Spiel von Licht und Dunkelheit spiegelt sich aber auch inhaltlich, etwa in der Szene mit der „dunklen Kammer“, in die Erfindungen Leibniz und seine Zettel mit Ideen verschwinden. Wie ist dieses Bild entstanden?
Diese Idee stand nicht im ursprünglichen Drehbuch. Aber als wir am Set waren, brauchten wir für meinen Monitor einen abgedunkelten Raum direkt hinter der Wand der Drehkulisse. Da saß ich also im Dunkeln, mit einer Tür zum Set. Lars Eidinger kam irgendwann und meinte „Der Film kommt aus dem Dunklen.“ Plötzlich war die Idee da, die Idee einer dunklen Kammer, in der die Ideen entstehen oder verschwinden. Ich habe die Szene sofort geschrieben, und wir haben sie nach und nach umgesetzt. Kantor, der Schreiber von Leibniz, führt die Malerin zu meiner schwarzen Kammer. Sie wird so zur Metapher für das Unbewusste, das kreative Dunkel.
Welche Überlegungen haben Sie grundsätzlich zur Bildgestaltung angestellt – zur Kameraarbeit, zur Lichtsetzung?
Wichtig war: Das Licht muss glaubwürdig sein. Es gab ja kein elektrisches Licht in der Zeit von Leibniz, nur Tageslicht. Die alten Ateliers hatten hochgelegene Fenster, damit das Licht von schräg oben einfällt. So eines haben wir im Studio nachgebaut. Unser Licht kam fast ausschließlich von draußen. Wir haben sehr genau auf Tageszeit, Wetter und Farbtemperatur geachtet.
Auch optisch wollten wir Zurückhaltung. Wir haben fast durchgehend mit nur einem Objektiv gedreht, einem 40-mm-Objektiv. Das entspricht ziemlich genau dem natürlichen Blickwinkel des menschlichen Auges.
Keine Zooms, keine Handkamera. Alles auf einem Dolly, auf Augenhöhe. Wir wollten keine aufdringliche Kameraarbeit, keine „dritte Person“, die sich automatisch ins Bild drängt, wenn mit Handkamera gearbeitet wird.
Als Zuschauer hat man so das Gefühl sehr unmittelbar als Zeuge dabei zu sein.
Ja. John Ford zum Beispiel hat seine Western fast ausschließlich mit der 40mm-Optik und aus 1,60 Meter Höhe gedreht. So haben wir es auch gehalten: Keine Kameraverrenkungen, keine spektakulären Winkel. Einfach das Bild auf Augenhöhe.
Co-Regie führt diesmal Anatol Schuster. Wie haben Sie die Zusammenarbeit organisiert?
Ein 92-jähriger Regisseur wird nicht mehr versichert. Da gibt es keine Ausfallversicherung mehr, die das Risiko übernimmt. Und man kriegt – was ja auch von den Förderern vorgeschrieben wird – diese Produktion überhaupt nur versichert, wenn man einen Co-Regisseur engagiert, der jeden Tag zur Verfügung steht. Für den Fall, dass der alte Mann ausfällt.
Ich habe Anatol Schuster dafür gewählt, weil ich ihn gut kenne. Ich habe ihn in der Zeit, in der er hier in München Film studiert hat, an der HFF, betreut. Ich habe seine Examensarbeit co-produziert. Und ich habe ihn bei allen seinen Filmen immer wieder beraten.
Er hat mir sehr geholfen. Ich war früher immer gewohnt, beim Drehen neben der Kamera zu sein. Nicht über den Monitor die Arbeit zu verfolgen, sondern direkt mit direktem Blick. Und ich habe den Schauspielern auch immer gesagt: Ich bin euer erstes Publikum. Ihr spielt für mich. Und das war hier nicht mehr machbar, denn einfach zehn Stunden am Stück stehen, das hält mein Rückgrat nicht mehr. Ich musste immer wieder sitzen. Dann hat man mir einen Monitor hingestellt. Und dann hatte ich Anatol. Ich hatte in meinem schwarzen Zimmer eine direkte Sprechverbindung mit ihm. Wir haben uns flüsternd verständigt während der Inszenierungsarbeit, sodass die Anweisungen immer ungebrochen ankamen.
Sie haben mit Edgar Selge, Aenne Schwarz, Barbara Sukowa und Lars Eidinger ein bemerkenswertes Ensemble versammelt. Wie haben Sie als Regisseur mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten gearbeitet?
Das war natürlich eine Hauptarbeit, auch in den Monaten vor Drehbeginn: das Ensemble zusammenzufinden. Die Idee, dass Edgar Selge die Hauptrolle spielt, stand ganz am Anfang. Er war für mich immer schon der Richtige. Ich kenne und bewundere Edgar Selges Arbeit schon lange – besonders tief beeindruckt hat mich sein Vortrag von Rilkes Duineser Elegien. Damit ist er immer wieder auf der Bühne aufgetreten. Und was ich so toll fand: Man glaubt bei seinem Vortrag wirklich, diesen schwierigen Text zu verstehen. Ich hatte das Gefühl, ich verstehe jedes Wort. Er kann diese Texte wirklich durchleuchten.
Ein weiterer Grund war: Edgar Selge ist ja auch als Schriftsteller hervorgetreten, mit seinem wirklich sehr bemerkenswerten autobiografischen Buch. Er hat ein besonderes Verhältnis zur Sprache. Und all das war für mich Anlass, mit ihm anzufangen – und das Ensemble um ihn herum aufzubauen.
Wie ging es dann weiter beim Casting?
Die erste Idee war Barbara Sukowa für die Rolle der Fürstin. Das ist ja eine kleine Rolle, aber sie braucht eine bestimmte Würde in der Ausstrahlung. Und die hat Barbara einfach. Dann kam die nächste Rolle: der Assistent, der Schreiber von Leibniz. Michael Kranz kannte ich von der HFF, er hatte da noch Dokumentarfilm studiert. Und er hat ein ungewöhnliches Gesicht, ein Gesicht, das aus einer anderen Zeit zu sein scheint.
Lars Eidinger ist natürlich ein Starschauspieler, eine Hochkarätige Besetzung. Aber ich hatte unglaubliche Freude daran zu sehen, mit welcher Kooperativität, mit welcher Hingabe er dabei war. In keiner Hinsicht arrogant oder sonst wie abgehoben, sondern flexibel, aufmerksam, nachdenklich. In jedem Augenblick bereit, alle Ideen, die ich hatte, auch umzusetzen.
Und Aenne Schwarz?
Aenne Schwarz kannte ich aus dem Film von Maria Schrader, wo sie die Ehefrau von Stefan Zweig gespielt hat – in Vor der Morgenröte. Sie ist eine vollkommen intuitive Schauspielerin. Bei ihr funktioniert das Ganze über die Situation. An ihr hat sich am allermeisten mein Konzept mit der Ausstattung bewährt, mit dem Raum. Sie reagiert wie ein Seismograf auf die kleinsten Dinge. Das ist ein Wunder an intuitivem Verhalten.
Sie haben Zeit Ihrer Laufbahn Theorien zum Film und zur Lage des Kinos präsentiert. Nun kann man sagen, dass das Kino nicht erst seit der weltweiten Pandemie einen krisenhaften Moment erfährt. Wie schätzen Sie die Aussichten für ihren Film mit seiner literarisch-philosophischen Färbung in der aktuellen Situation auf dem Markt ein?
Ich bin sehr gespannt. Was ich immer wieder mit Freude höre, ist: „Es ist ein Vergnügen, den zu sehen.“ In Berlin bei der Premiere wurde viel gelacht, in einem Saal mit über 800 Menschen. Es gab große Heiterkeit, und das hat mir am allerbesten gefallen. Leibniz hat einmal gesagt, das größte Vergnügen, das er kennt, ist das Denken. Der Mensch ist beim Denken vergnüglich und frei. Und es bekommt uns gut, das Denken. Das ist meine Hoffnung.
Ich bin überzeugt, dass es viele Leute gibt, die nicht mehr gewohnheitsmäßig ins Kino gehen, weil sie sich dort unterfordert fühlen. Intellektuell unterfordert. Ich habe das sehr oft gehört: „Endlich ein intelligenter Film, der mich herausfordert, der mich auf neue Gedankenwege führt, der mir zeigt, dass Denken Freude macht.“ Das erzeugt ein Gefühl der Befreiung. Deswegen hoffe ich, dass es für Leibniz ein großes Publikum gibt.
Tatsächlich ist Ihr Leibniz-Film von einem überraschend heiteren Ton getragen.
Der Humor entsteht durchs genaue Hinschauen. Diese eine Szene zu Beginn – wenn der Hofmaler dem Leibniz Anweisungen gibt, wie er schauen soll – und dann sagt: „Lieber gar nichts denken.“ Einem Philosophen zu sagen, er solle nicht denken, das ist an sich schon ein Witz. Das kommt sofort an.
Mit Leibniz präsentieren Sie nun einen alleinstehenden Film. Berühmtheit haben Sie mit Ihrem Heimat-Zyklus und seiner seriellen Erzählweise erlangt. Nun erlebt die serielle Form seit vielen Jahren schon eine Hochphase. Wie beobachten Sie das heutige Serienerzählen? Und inwiefern fügt sich Leibniz in Ihr Gesamtschaffen?
Ich war kürzlich in Italien, wo meine Biografie Filmzeit, Lebenszeit gerade auf Italienisch erschienen ist. Da schrieben einige Zeitungen, Heimat sei die Mutter aller Serien…
Die klassische Filmproduktion – der internationale Spielfilm – folgt der Tradition des Dramas. Das Drama, wie es schon Aristoteles im antiken Griechenland beschrieben hat, war die Grundlage für Hollywood und das internationale Kino.
Aber ich hatte nie Spaß an der forcierten Dramatik. Ich fühlte mich nicht talentiert fürs Drama. Deshalb haben meine Filme sich von Anfang an gegen die Regeln des dramatischen Erzählens gewehrt. Bis ich irgendwann das Epos entdeckt habe oder wie ich es nenne: die Chronik. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen: Alle meine Filme heißen „Chronik“. Chronik einer Jugend, Chronik einer Zeitenwende, Chronik einer Sehnsucht, Chronik eines verschollenen Bildes…
Das habe ich in den 1980er Jahren entdeckt, dass mein eigentliches Talent das chronikartige Erzählen ist. Horizontal, nicht vertikal. Es geht mir nie um das Ende. Das Drama steuert ja immer auf ein Ende hin, um die Katharsis auszulösen, wie Aristoteles das beschreibt. Das ist Theater. Und das wird auch immer ein Grundgesetz des Theaters bleiben. Aber das Kino muss sich davon lösen. Es braucht eine andere Verbindung zum Leben. Das Epos ist dem Leben, wie es sich in Filmbildern darstellt, näher als das Drama.
Und schauen Sie aktuelle Produktionen, etwa bei Netflix?
Ich habe zum Beispiel diesen Mehrteiler Adolescence gesehen. Das ist ein sehr bemerkenswertes Werk, da wurde die Plansequenz neu entdeckt. Diese Einheit von Zeit und Erzählung, das spielt dort auf eine sehr interessante Weise zusammen. Und die Inszenierung ist hochvirtuos. Das hat mir gefallen.
Wie geht es künstlerisch für Sie weiter?
Ich arbeite im Moment an einem Drehbuch, über das ich nicht sprechen möchte. Es ist eine bange Frage – ich bin fast 93, – ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Natürlich muss ich damit rechnen, dass es irgendwann nicht mehr geht. Aber nichts zu tun, halte ich in meinem Alter für gefährlich.||
LEIBNIZ – CHRONIK EINES VERSCHOLLENEN BILDES
Regie: Edgar Reitz | Mit: Edgar Selge, Lars Eidinger, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz, Antonia Bill, Michael Kranz | 104 Minuten
Kinostart: 18. September
Das könnte Sie auch interessieren:
Es passiert andauernd: Interview mit Alina Cyranek zu ihrem Dokumentarfilm »Fassaden«
Knochen brechen: Filmkritik zu »No Other Choice« von Park Chan-wook
Stummer Lehrmeister: Ildikó Enyedis »Silent Friend« im Kino
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!
Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.
Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.
JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton