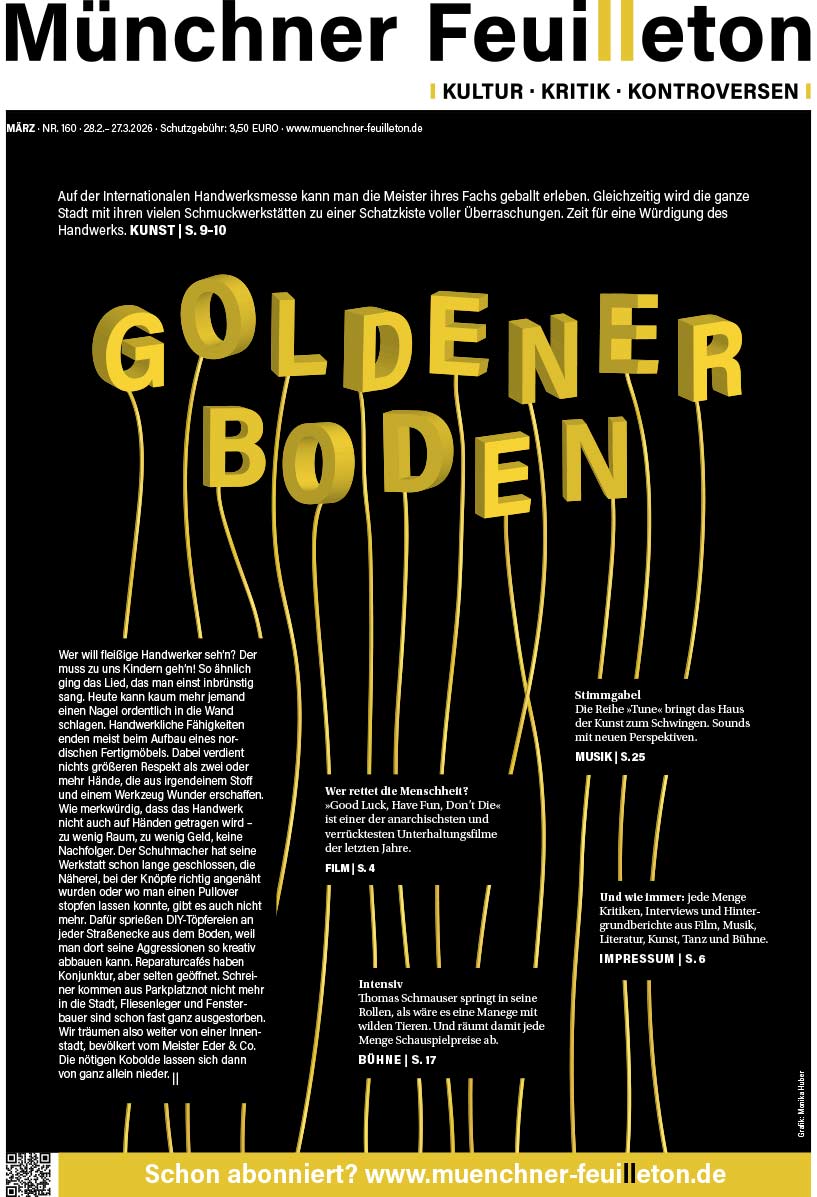Spielt der Klimawandel für die Politik noch eine Rolle? Die Kultur macht jedenfalls nicht die Augen zu, wie drei Ausstellungen in München demonstrieren.
Klimawandel
Kurz vor dem Kollaps

Jürgen Winkler: »Gletscherdecke« | Mit Planen aus Polypropylen versucht man im Sommer die Eisreste zu schützen © Jürgen Winkler
Ratlosigkeit und Wut stellen sich bei vielen angesichts des Klimathemas ein. In den USA bestimmen nun wohl Leugner des Klimawandels die Geschicke des Staates, der die Weichen stellt. Hierzulande spielt die größte globale Herausforderung der Menschheit für die neue Regierung offensichtlich zukünftig nur noch eine untergeordnete Rolle. Klimaschutz läuft quasi unter »Wirtschaftswachstum«. Wichtig dabei für die Koalitionäre: Wettbewerbsfähigkeit und soziale Ausgewogenheit. Reicht das, um in Sachen Klima die globale Kurve zu kriegen? Oder will man damit nur die nächste Wahl nicht verlieren?
Beim Besuch dreier Münchner Ausstellungen – im Alpinen Museum, im Verkehrszentrum des Deutschen Museums und in der Pinakothek der Moderne – kann man da so seine Zweifel bekommen, dass das klappt. In der Summe zeigen diese, dass es höchste Zeit ist, der Klimarettung oberste Prioritäten einzuräumen.
Aber da (die Hoffnung) aufgeben diesbezüglich die schlechteste aller Entscheidungen ist, hoffen wir mal, dass die Empfehlungen und Warnungen der Kulturinstitute etwas bewirken und dass die Lösungsansätze ernst genommen werden. Zuerst versuchen sie, fürs Thema zu sensibilisieren: Am besten eigen sich dafür die Frühwarnsysteme. Als da sind: Alpen, Arktis, Wälder. Allheilmittel haben aber weder Kuratoren noch Künstler parat. Klar wird jedoch: Gegen die Aufheizung des Globus kann und muss jeder Einzelne selber etwas tun. Resignieren ist so falsch wie Ignorieren. Man muss an seinem eigenen Verhalten etwas – oder vieles – ändern.
Zu mehr Miteinander mit der Natur selbst rät uns das Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne in der Ausstellung: »Trees, Time, Architecture!«. Dabei geht es erst einmal nicht ums Bauen mit Holz, sondern um die Integration lebender Bäume in die architektonische Planung. Schließlich weiß man inzwischen, dass diese mit ihren großen Kronen, durch Schatten und Verdunstung dazu beitragen, die Temperaturen in städtischen Hitzeinseln zu senken und so die Lebensqualität einer urbanen Bevölkerung zu verbessern. Außerdem sind sie CO2-Speicher – und im Normalfall giftfrei und ökologisch einwandfrei. Bauten werden gezeigt, die Bäume in die Gebäude integrieren, oder Bauwerke, etwa Brücken, die ganz aus wachsenden Pflanzen bestehen. Außerdem viele Ideen, Projekte, Prozesse, Objekte. Dazu zählen nicht nur der legendäre, mit Bäumen auf den auskragenden Balkonen bestechende »Bosco Verticale« (senkrechter Wald) von Stefano Boeri in Mailand, sondern auch traditionelle, lebende Brücken im indischen Bundesstaat Meghalaya. Diese werden aus den Luftwurzeln des Gummibaums gezogen, verbinden als Teil des ländlichen Wegenetzes ganze Dörfer miteinander und sind inzwischen auch touristische Anziehungspunkte. Zu sehen sind natürlich auch Baumhäuser sowie Strukturen, bei denen wie im Platanenkubus von Nagold die Bäume mit Hilfe eines Gerüstes im Laufe der Zeit zu einer selbsttragenden Struktur verwachsen, einem pflanzlichen Organismus zum Gebrauch durch den Menschen.

Der Bikepark Leogang in der Ausstellung »Zukunft Alpen« © Thomas Einberger
Um etwas Ähnliches – allerdings in weit größerem Maßstab – geht es im Alpinen Museum. Dort widmet man sich unter dem Titel »Zukunft Alpen« der Entwicklung dieser Gebirgslandschaft unter Einbeziehung der Bevölkerung und des Tourismus. Das heißt: Möglichkeiten zur Rettung der Alpen aufzuzeigen, die besonders von der Erderwärmung betroffen sind und sein werden. Ohne Gegenmaßnahmen werden die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts dort deutlich stärker steigen als im globalen Durchschnitt. Rund fünf Grad im Vergleich zur Referenzperiode von 1971 bis 2000 im bayerischen Alpenland, so sagen Experten. Je nach Region und Jahreszeit kann es auch noch wesentlich mehr sein. Der Wandel von Temperatur und Niederschlag hat immense Auswirkungen auf Biodiversität, Flora, Fauna und auf die Gestalt der Landschaft. Manche Pflanzen und die von ihnen abhängigen Tiere werden sicher verkümmern und aussterben. Wie das im Detail aussehen wird, kann man an verschiedenen Stationen der aufwendigen und informativen Schau nachvollziehen.
Auch die Gefahren in der alpenländischen Natur werden immer größer. Für den Bergsport, auch Wanderer zählen dazu, bedeutet dies erhöhte Gefahr für Leib und Leben durch vermehrte Steinschläge, Muren, Erdrutsche, Lawinen oder unberechenbare Wetterkapriolen. Wege werden unpassierbar – was das in 3000 Metern Höhe und ansonsten unwegsamem Gebiet bedeutet, kann man sich ausmalen. Und möglichst schnell umdrehen. Aber wir wissen: Schlimmer geht immer!
Die 79 Gletscher in Österreich haben im Durchschnitt 23,9 Meter allein von 2022 bis 2023 an Länge verloren. Dadurch geht zuerst einmal nur den Hütten in den Bergen das Wasser aus. Später passiert das dann im Tal. Aber auch Anpassungsstrategien hinterlassen Spuren. Schließlich sind die Alpen wegen ihrer geringen Besiedlungsdichte und ihres starken Reliefs für den Gewinn alternativer Energien ausgesprochen attraktiv. Windradparks, ausgedehnte Solarkraftwerke und neue Wasserkraftwerke sollen den Energiehunger der Flachländler stillen. Naturschützer schlagen Alarm, stellen aber auch durchdachte alternative Konzepte vor. Etwa: Wie man ohne fossile Energie mit dem Fahrrad, kombiniert mit dem Nahverkehr, in die Berge kommt – und vieles mehr.
Im Foyer des Hauses schaut man dann dem heutigen Horror in den Bergen direkt ins Gesicht: Jürgen Winkler, der seit den1950er Jahren als Bergsteiger und Fotograf unterwegs ist und viele Bücher publiziert hat, zeigt in der Ausstellung »Klimaerwärmung« beeindruckende Fotografien. Kaum zu glauben, dass man aus Schneekanonen, Lawinenschutz, Kunstschnee, Gletschervlies, den zur Aufrechterhaltung des alpenländischen Freizeitzirkus nötigen Maschinenparks oder den in schönster Gebirgslandschaft ausgefahrenen wüsten Kurven der Mountainbiker ästhetisch so beeindruckende Aufnahmen komponieren kann. Ungeschminkte Hässlichkeit in schönen Bildern. Das stimmt nachdenklich und rüttelt auf.
Um Gefrorenes geht es im Verkehrszentrum des Deutschen Museums auf der Theresienhöhe. Unter dem Titel »Dünnes Eis« nimmt man den Besucher mit auf die 2019 gestartete Klimaexpedition des Forschungsschiffs Polarstern. Eisiger Wind, klirrende Kälte und monatelange Dunkelheit fehlen zwar. Dafür erfährt man aber, wie man in der Arktis forscht, die Eisdicke misst, nach Kleinstlebewesen sucht – oder schlussendlich herausfindet, wie lange es wohl noch mehrjähriges Eis geben wird. Mit dicken Polarhandschuhen kann man – wie an Bord des Eisbrechers – Messinstrumente zusammenschrauben. Auch findet man eine anschauliche, wie auf dem ewigen Eis selbst gebaute Hütte, die dem Eisbärenwacht-Team auf der Polarstern Schutz bot. Ein wesentliches Ziel der Schau, die sich spielerisch besonders an die (ganz) Jungen richtet: Bewusstsein für die Probleme schaffen. Taten – hoffentlich die Erfolg versprechenden – sollten dann auch bald folgen. ||
TREES, TIME, ARCHITECTURE!
Pinakothek der Moderne, Architekturmuseum der TU München | Barer Str. 40 | bis 14. Sept. | Di bis So, 10–18 Uhr, Do bis 20 Uhr
ZUKUNFT ALPEN
KLIMAERWÄRMUNG. FOTOGRAFIEN VON JÜRGEN WINKLER
Alpines Museum | Praterinsel 5 | bis 30. Aug. 2026 | Di bis So, 10–18 Uhr | Fotoausstellung Jürgen Winkler (Eintritt frei) bis 22. Juni | Info und Veranstaltungen
DÜNNES EIS – KOMM MIT AUF KLIMA-EXPEDITION!
Verkehrszentrum | Am Bavariapark 5 (Theresienhöhe) | bis 9. Nov. | tägl. 9–17 Uhr | Info und Veranstaltungen
Weitere Besprechungen finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.
Das könnte Sie auch interessieren:
Der digitale Impressionist: Immersive Ausstellung von Miguel Chevalier in der Kunsthalle München
Mehr als ein Spielplatz: Ausstellung im Haus der Kunst
Löwenstark und papageienbunt
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!
Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.
Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.
JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton